Ihr Lieben, es gibt Texte, die einen sehr berühren und an denen wir nicht ein Wort ändern müssen oder wollen. Weil sie so perfekt sind wie sie sind. So wie dieser Text von Isabell, die ein sehr enges Verhältnis zu ihren drei verstorbenen Schwestern hatte. Hier erzählt sie uns von dieser wunderschönen Verbindung, vom Loslassen, von der Trauer und vom Weitermachen.
Fast schon fröhlich tanzen die bunten Blumen auf dem Wasser. Ranunkeln, Sonnenblumen, Disteln, Nelken. Pink, orange, gelb, kornblumenblau und grün. Die Sonne, die sich wie auf Kommando beim viermaligen Doppelschlag der Schiffsglocke durch die dichte Bewölkung des Oktobermorgens kämpft, schickt warme Strahlen auf das Meer und auch auf uns. Alles ist bunt und golden. Acht Glasen. Das steht in der Seefahrt nicht nur für das Ende einer Wache, es steht auch als Symbol für den Übergang vom Leben zum Tod.
„I say love, it is a flower“. (The rose)
Und unter den Klängen von „The Rose“ versinkt die Urne mit der Asche meiner Schwester langsam in der Nordsee. Lange stehen wir an der Reling, eng umschlungen und können uns nicht loslassen. Nicht den Blick abwenden von den Wellen und den tanzenden Blumen. Meine Nichte, die gerade Abschied von ihrer Mama nimmt. Meine andere Nichte, die im Mai ihre Mama verloren hatte. Meine Tochter, die einzige der Cousinen, die noch eine Mutter hat. Und ich. Ich hatte jetzt die letzte meiner drei Schwestern verloren.
Wir waren vier Schwestern
Wir waren vier. Vier Mädchen. Unser Vater sagte immer, das Beste, was einem Mann passieren könnte. Vier Töchter. Ich war die Jüngste, das Nesthäkchen mit großem Abstand, 17, 15 und 10 Jahre jünger als die Großen. Von allen erzogen, verzogen, verwöhnt, genervt, gegängelt, geärgert, geliebt. Wie das so ist mit Geschwistern.
Als unser Vater innerhalb von zehn Tagen an Krebs starb, da hatte ich gerade angefangen zu studieren. Unsere Mutter, schon immer geradezu krank vor Heimweh, zog zurück in ihr Heimatland und behielt Zeit ihres Lebens ein distanziertes Verhältnis zu uns zurückgebliebenen Kindern und Enkelkindern.
Familie, das waren jetzt meine Schwestern und mein Freund, den ich ein paar Jahre später heiratete. In ein paar Wochen feiern wir Silberhochzeit und dann werden wir bestimmt unsere Hochzeitsalben durchblättern, mit vielen Fotos meiner Schwestern. Und ich werde mich wieder fragen: Wie konnte das passieren, dass niemand von ihnen mehr da ist? Sie alle drei nicht meine Silberhochzeit mit mir feiern?
Meine Schwester starb zwei Monate nach der Diagnose
Kurz vor dem ersten Geburtstag meiner ältesten Tochter wurde bei meiner zweiten Schwester ein sehr aggressiver Tumor entdeckt. Und schon zwei Monate später mussten wir von ihr Abschied nehmen. Die Lücke, die sie hinterließ war nie zu schließen. Wir machten ohne sie weiter, aber sie war immer präsent.
Unvergessen, wie sie mit mir am Tag vor meiner Hochzeit durch die Geschäfte jagte, um ein blaues Strumpfband zu finden. Denn ohne „something old, something new, something borrowed, something blue“ wollte sie mich nicht vor den Altar treten lassen. Ob an dem Aberglauben etwas dran war? Immerhin sind wir seit fast 25 Jahren glücklich verheiratet, und nicht wie meine Schwestern alle geschieden.
Älter zu werden, als meine Schwester es jemals wurde, war ein komisches Gefühl. Sie war ja immer die ältere Schwester gewesen. Und jetzt war ich älter. Ich werde sie nie als ältere Frau sehen, dachte ich häufig. Auf ewig konserviert in ihrem Todesalter. Vor Augen hatte ich oft das Häufchen Elend, das sie wenige Stunden vor ihrem Tod war. Die großen braunen Augen weit aufgerissen in ihrem eingefallenen Gesicht. Ihr schmaler Körper ausgezehrt von der grausamen Krankheit. So ein Hohn, braungebrannt vom kaum vergangenen Sommer.
Meine Schwester war so tapfer
Weiter ging es in unserem trubeligen Alltag. Arbeit, Kinder, Tiere, ihr kennt es alle. Wir waren jetzt die vier Schwestern, von denen eine nur noch in unseren Gesprächen da war. Drei Schwestern und eine sehr präsente Lücke. Wir hatten einfach Pech, dachten wir.
Leider war das Pech noch nicht fertig mit uns. Schluckbeschwerden, sagt meine dritte Schwester. Immer, wenn sie Nudeln isst, hat sie Schluckbeschwerden. Nicht sonderlich schlimm, aber irgendwie komisch. Speiseröhrenkrebs ist die niederschmetternde Diagnose. Die Anfangs gute Prognose, die erfolgreiche Operation beim besten Spezialisten, das alles entpuppte sich als Kampf gegen Windmühlen. Bei der ersten großen Nachuntersuchung waren dann doch Metastasen da, die Aussicht auf Heilung war dahin. Und dann hat sie gekämpft, meine tapfere Schwester. Mit fast übermenschlicher Kraft. Jede Therapie klaglos ertragen, immer weiter gemacht und nicht aufgegeben. Bis zum Schluss.
„Ich liebe es so sehr, das Leben“ flüsterte meine Schwester, ein kleines Häufchen Elend auf unserem Sofa. Es war der Geburtstag unserer jüngsten Tochter Ende Januar. Bis zuletzt hatten wir kaum zu hoffen gewagt, dass sie überhaupt kommen konnte, zu schwach war sie in den letzten Wochen gewesen. Doch sie hatte sich aufgerafft. Diese Geburtstagsfeier war eins der vielen „letzten Male“, die sie ganz bewusst absolvierte. So wie die Hochzeit ihrer Tochter im Sommer davor, ein Weihnachtsfest mit müde getanzten Füssen und das Anstoßen auf den Studienabschluss ihrer Tochter.
Mit so viel Würde und immer ganz bei sich gestaltete sie den Abschied von dieser Welt, an der sie so sehr hing. Bestellte mich zum Abschiednehmen ein, in dem Wissen, kurze Zeit später nicht mehr genügend bei Bewusstsein zu sein für diesen zwar traurigen, aber auch sehr schönen Moment. Vier Jahre hatte sie gekämpft. Vier Jahre voller Hoffen, Bangen und Tränen, aber auch voller kleiner Glücksmomente. Ab Ostern haben wir jeden Tag gewünscht, sie könne einschlafen. Das hört sich grausam an, aber ihre Qual war so groß, wir konnten ihr einfach nur noch wünschen, dass es endlich vorbei ist. Wir wollten sie so gerne bei uns behalten, doch nicht zu diesem Preis, nicht mit diesen Schmerzen.
Im Mai schloss sie ihre Augen. Genau wie sie es sich gewünscht hatte. Zuhause. Mit geliebten Menschen und den Hunden. Wir haben den ganzen Tag mit ihr verbracht, bis der Bestatter kam. Erzählt, Kaffee getrunken, ihre Anweisungen für die Zeit nach ihrem Tod gelesen. Sie hatte alles bis ins Detail geplant. Den Ort der Trauerfeier, die Lieder, die Anzeige. Einfach alles.
So eine Größe, im Angesicht des Todes alles genau zu planen, um ihre Mädchen in ihrer Trauer nicht alleine zu lassen. Im Tresor etwas Bargeld. Ein Kärtchen: „Für X.s Brautkleid“. Für die andere Tochter hatte sie im Jahr davor das Brautkleid gekauft. Ich frage mich so oft, wie sie sich gefühlt hat in diesem Moment. Wie traurig sie gewesen sein muss. So viel Leben, das ohne sie stattfinden wird. Der Gedanke an diesen Augenblick treibt mir die Tränen in die Augen.
Nach dem Tod war erstmal nur Leere
Der Tag nach der Trauerfeier war mein Geburtstag. Wir haben gefeiert und sind dann direkt zu einer lange geplanten Kurzreise aufgebrochen. Wir hatten Karten für Ludovico Einaudi, es war alles sehr schön, aber wie in einem Tunnel. Alles rauschte nur so an mir vorbei und wieder zuhause fiel ich in ein ganz tiefes Loch. Der Alltag funktionierte, doch die Trauer nahm mir immer wieder den Atem. Abends im Dunkeln bei der letzten Hunderunde stöpselte ich mir meine AirPods in die Ohren, hörte meine „Miss You“-Playlist und weinte.
Ein Lied davon hatte meine Schwester sich für ihre Trauerfeier ausgesucht. „Ohne Dich“ von Rammstein. „Als ich fortging“ von Karussell hatte ich zugefügt. Das Lied hatte sie noch vor der Wende im Abspann eines „Polizeiruf 110“ im DDR-Fernsehen gehört, den Sender angeschrieben, was das für ein Lied sei und sogar eine Antwort aus dem Osten bekommen. „Fix You“ von Coldplay. „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. „Ich würd dich gern besuchen“ von Unheilig. Wenn die Playlist durch war, hatte ich meistens genug geweint, um anschließend schlafen zu können. Den Finger in die Wunde legen, damit es hinterher nicht mehr so weh tut.
So verging der Juni, der Juli und der August. Ein paar Tage an der See und in den Bergen halfen mir, wieder etwas Kraft zu schöpfen. Ein bisschen fühlte ich mich immer noch, als hätte ich einen Marathonlauf hinter mir, aber es ging in kleinen Schritten aufwärts.
Mein Handy klingelte. Das passierte zigmal am Tag, aber dieses Klingeln an einem Mittwochvormittag im September verhieß nichts Gutes. Auf dem Display stand der Name meiner ältesten Nichte, der Tochter meiner ältesten Schwester. Meiner letzten noch lebenden Schwester. Ein Anruf meiner Nichte ist natürlich immer etwas Schönes, wir stehen uns sehr nah und quatschen ziemlich viel miteinander. Per Sprachnachricht.
Und das ist der Grund, warum ich sofort eine Gänsehaut hatte. Normalerweise verabreden wir uns immer zum Telefonieren. Unsere Jobs, ihre noch sehr kleinen Kinder, ihr kennt das. In Ruhe telefonieren will gut geplant sein.
Auch meine dritte Schwester hat Krebs
Mit diesem Klingeln war also schon gleich klar: es ist etwas passiert. Das Unvorstellbare war passiert. Die letzte meiner Schwestern lebte nicht mehr.
Einige Monate zuvor war auch bei ihr eine Tumorerkrankung festgestellt worden. Eher ein Zufallsbefund, keine Panik, alles gut im Griff. Und nun hatte sie die Vollnarkose bei einem kleinen, spontanen Routineeingriff nicht überlebt. Eine Ironie des Schicksals. Sie war Narkoseschwester.
Und wieder viel ich in ein Loch. Diesmal in ein ganz Tiefes. Ohne Boden. Sicher, die Trauer um meine älteste Schwester war auch groß, aber das, was mich schier zerbrechen ließ war tatsächlich die Trauer um meine dritte Schwester, die im Mai gegangen war. Ihr Tod wurde mir erst jetzt in vollem Ausmaß bewusst. Holte mich ein wie ein Bumerang. Ich hatte ständig das Bedürfnis, mit ihr über den Tod unserer ältesten Schwester zu sprechen.
Niemals vorher habe ich sie so sehr vermisst wie in diesen Tagen. Die „Miss you“-Playlist lief nicht nur abends bei der Hunderunde. Sie lief immer, wenn meine Familie es nicht mitbekam. Ich wollte den ganzen Schmerz spüren, war aber völlig taub. Konnte mich selbst nicht mehr leiden in meiner Dunkelheit. „Schon wieder ein Tag, an dem ich mich selbst ertragen muss“ war morgens mein erster Gedanke. Und hasste mich dafür. Ich sollte dankbar sein, schließlich war ich ja noch am Leben! Wie sollte ich aus diesem Tief wieder herausfinden?
Die See-Bestattung gab mir Frieden
Ungefähr einen Monat nach dem Tod meiner Schwester war die Seebestattung ihrer Urne. Das Meer war ihr Leben, als junge Frau ist sie bei Regatten mitgefahren, sie lebte an der Nordsee und war bei Wind und Wetter am oder im Wasser. Dazu noch ein rastloser Geist, ihr letzter WhatsApp-Status: Heute hier, morgen dort. Wir mussten nicht lange überlegen, das Meer war ihr Hafen.
Für den Tag nach der Seebestattung nahm ich mir frei. Den Tag wollte ich zum Trauern haben, meine Wunden lecken und mir weiter selbst leidtun. Ich dachte, ich wäre bestimmt voll im Eimer.
Und es kam ganz anders. Das Meer, die Musik, die bunten Blumen und vor allem der Sonnenstrahl. Es war magisch. Voller Frieden. Würdevoll.
Meine Nichten, meine Tochter und ich, wir haben es alle gespürt. Sie waren da, meine Schwestern, alle drei. Es war ein Abschied, aber voller Zuversicht und Hoffnung. Es war traurig, aber auch voller Glück. Klingt verrückt. Muss man erlebt haben.
Ich liebe meine Schwestern so
Und wie ging es weiter? Am nächsten Tag war meine Energie zurück. Einfach so. Und ich konnte endlich anfangen, die Fäden in meinem Leben wieder aufzunehmen. Vieles war liegengeblieben, vieles in meinem Leben habe ich durch dieses Trauma, alle meine Schwestern zu verlieren, neu auf den Prüfstand gestellt.
Ich lebe mit der Aussicht, vielleicht auch nicht sehr alt zu werden. Aber letztendlich weiß niemand, wann seine Zeit gekommen ist. Ich möchte meine Zeit mit Leben füllen. Mit meinem Mann und meinen Töchtern glücklich sein. Die richtigen Prioritäten setzen. Für meine Nichten da sein. Das Leben genießen, auch wenn es zwischendurch immer wieder Momente geben wird, in denen die Dunkelheit der Trauer an mir nagt.
Die Erinnerung an meine drei großen Schwestern bleibt. Ich habe sie sehr lieb.
When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun’s love
In the spring becomes the rose
(The rose)




















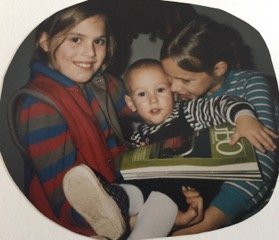






9 comments
Danke für diesen Text, irgendwann werde auch ich wieder Kraft haben und Trost finden.
Meine kleine Schwester ist vor 2 Tagen gegangen, nach nur 2,5 Monaten Kampf. Ich fühle mich wie ausgeschaltet. „Als ich fortging“ haben wir auch ausgesucht.
Danke für diesen Text, liebe Isabell. Wie bei manch anderer Geschichte hier frage ich mich, wie man so viel Schmerz und Leid ertragen und überwinden kann. Es macht mir Angst vor dem Tag, an dem ich einen geliebten Menschen verlieren werde. Ich kann nur hoffen, dass ich dann auch nur halb so stark bin, wie du es bist. Dir und auch Jule viel Kraft und alles Liebe.
Hallo, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas kommentiert im Netz.
Dieser Artikel aber, spricht mir so sehr aus dem Herzen. Auch ich habe meinen Vater letztes Jahr an den Krebs verloren und meine „kleine“ Schwester kämpft gerade gegen ihn. Auch ich habe schon einmal das Schwert gegen ihn erhoben und gewonnen. Liebe Isabell, ich hoffe du liest meine Zeilen, ich verstehe dich so sehr und ich sitze hier und mir laufen die Tränen über das Gesicht. Deine abendlichen Hunderunden, die Musikplaylist, all das kommt mir so bekannt vor.
Wie bist du mit der Hilflosigkeit und Trauer umgegangen? So gerne würde ich mehr von dir hören oder lesen.
Danke für deine Geschichte.
Und allen, die sich über eine Himmelsrichtung und deutsche Geschichte auslassen, haben hoffentlich noch nie die Trauer empfunden, die Isabell uns offen gelegt hat.
wow. Sehr berührend und schrecklich zugleich. Wurde geprüft, ob in der Familie ein krebsgen vorhanden ist vonseiten des Papas? 4 Tote innerhalb kürzester Zeit ist ja sehr ungewöhnlich. Ich meine ihr hattet hier mal über eine Familie berichtet, wo der Papa und die beiden großen Kinder daran gestorben sind.
Sie schrieb doch „vor der Wende“. Da gab es eben doch Osten und Westen.
Ein sehr berührender Text! Das Lied „Als ich fortging“ haben wir vor 1,5 Jahren auch bei der Beerdigung meiner Mutti gespielt. Und als es geschrieben wurde, gab es tatsächlich noch ein Westdeutschland und ein Ostdeutschland. Wenn man den Text ganz genau hört, dann hört man es auch in dem Lied. Meine Mutti war damals eine junge Frau und ich ein Kind. Es war die Zeit, als so viele fort gingen, als es immer wieder neue leere Plätze in meiner Klasse gab und Wohnungen am Abend dunkel blieben. Obwohl ich noch in der Grundschule war, kann ich mich noch gut an das Gefühl dieser Zeit erinnern. Daher finde ich es in diesem Text okay von Post aus dem Osten zu sprechen, denn es bezieht sich auf die Zeit, als Deutschland noch geteilt war. In Berichten aus der Gegenwart finde ich es deplatziert! Es gibt seit über 30 Jahren ein Deutschland, was Gott sei Dank in Frieden wieder vereint wurde!
Anne… es geht um einen Zeitpunkt vor der Wende, Post aus der DDR als Post aus dem Osten zu bezeichnen ist doch korrekt.
Der Text ist so schön und so ergreifend, da finde ich es unangebracht, sich an einem Detail zu stören und dies zu benennen, obwohl es überhaupt nicht diskriminierend ist.
Ich wünsche Isabell und ihren Nichten alles Gute!
Ein berührender Post. Trotzdem stößt mir die Formulierung „…sie bekam Post aus dem Osten“ auf. Es gibt kein Osten und kein Westen nur ganz Deutschland. Wann wird das endlich kapiert.
Bei so einem Artikel ist es sicherlich schwierig genug, überhaupt Worte zu finden. Da finde ich es nicht angemessen, wenn jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Abgesehen davon wurde ja „Osten“ und nicht „Ostdeutschland“ geschrieben. Damit ist doch einfach nur eine Himmelsrichtung gemeint. Hätten Sie sich am Wort „Norden“ oder „Süden“ auch so gestört?