Dublin. Von unserem Bed and Breakfast bis zum Hafen braucht man circa eine Stunde zu Fuß. Das schätze ich jedenfalls. Und ich glaube sogar zu wissen, dass der Check-in für die Fähre nach Cherbourg (Normandie) um 15 Uhr beginnt. Ohne einen weiteren Blick aufs Ticket oder auf GoogleMaps zu werfen, gehen wir los. Wir, das sind: Meine Tochter (12), mein Sohn (15) und ich. Meine Frau, die nicht wie ich sechs Wochen Sommerferien hat, ist am Tag zuvor bereits nach Hause geflogen.
Meine Frau ist in vielerlei Hinsicht anders als ich – aber Gegensätze ziehen sich ja manchmal an. Sie kontrolliert zum Beispiel jeden Weg auf GoogleMaps. Und ständig schaut sie, wie das Wetter ist und wie es wird. Natürlich vergewissert sie sich vor jeder Fahrt, ob der Bus/die Bahn/das Schiff auch pünktlich abfährt und wann man genau wo sein muss. Nicht einmal, sondern mehrfach. Entsprechend geht nie etwas schief.
Bei mir ist es umgekehrt: Immer geht etwas schief! Der Fußmarsch zum Hafen endet zum Beispiel in vollkommenem Chaos. Das, was zu einem kurzen Alptraum wird, beginnt so gegen halb drei, als ich meinem Sohn das Ticket gebe, weil ich meine Jacke ausziehen will. (Ich habe es in der Hand gehalten, weil ich dachte, wir seien ja eh gleich da.)
„PAPA… Check-in ist nicht ab 15 Uhr, sondern bis 15 Uhr!“, sagt er und guckt mich mit seinem Typisch-Papa-Blick an.
„Ach Papa“, murmelt meine Tochter in ihrem unverwechselbaren Nicht-schon-wieder-Tonfall.
„Kein Problem, wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit“, sage (und hoffe) ich. Ich irre mich jedoch. Man kommt nämlich nicht direkt zum Fährhafen, man muss erst weiträumig um einen Containerhafen herumgehen.
„Papa… es ist viertel vor drei!!!“, sagt mein Sohn irgendwann und schüttelt den Kopf, ob aus Wut oder Verzweiflung, weiß ich nicht. Meine Tochter hat inzwischen Tränen in den Augen. Wir alle wissen, dass die Fähre nur alle zwei Tage fährt. Ich selbst habe inzwischen einen ganz trockenen Mund – denn bis zum Anlieger ist es noch weit. Inzwischen versuche ich mit hektischen Handbewegungen Autos anzuhalten.
Zehn vor drei.
Um acht vor drei hält ein Taxi. Wir werfen unser Gepäck geradezu in den Kofferraum und springen auf die Rückbank bzw. auf den Beifahrersitz. Ich brauche dem Taxifahrer nicht zu sagen, dass wir es eilig haben. Das hätte uns sogar ein Dreijähriger angesehen. Das Taxi fährt schnell und braucht trotzdem fünf Minuten. Der Taxifahrer ist wie fast alle Iren herzlich und unfassbar nett und hilfsbereit, und schon im Taxi denke ich: Diesen Mann hätten wir nie kennengelernt, wenn auch ich immer versuchen würde, im Vorfeld jedes Restrisiko auszuschließen.
Endlich sitzen wir im Wartebereich, und spätestens in diesem Moment fällt die ganze Spannung von uns ab. Wir lachen, Sätze wie „Das erzählen wir Mama lieber nicht“ fallen, und dabei gucken wir uns fast schon verschwörerisch an.
Auf unserer ersten smartphonefreien Wanderung in der Bretagne habe ich mich einmal um vier Kilometer verschätzt – zu einem Zeitpunkt, als wir schon 23 Kilometer mit vollem Gepäck unterwegs waren. Ich hatte dann etwas getan, was heutzutage kaum mehr jemand tut, weil ja alle dank des stets griffbereiten Handys eh alles nachgucken oder Siri fragen können: Ich habe Leute angesprochen und mit ihnen geredet.
Ein Jahr später sind wir vollkommen eingeregnet und haben uns mal wieder verlaufen. Eine Stunde lang irrten wir im strömenden Regen durch ein Waldstück, zwischendurch verfolgt von einem streunenden Hund. Zugegeben, wir waren in dieser Situation nicht besonders glücklich. Aber dieser Rausch, der sich in der Sekunde einstellt, in der man eine schwierige Situation gemeistert hat und der oft minuten- und manchmal stundenlang andauert, der ist einfach unvergleichlich.
Ohne digitale Hilfe unterwegs zu sein, ist heutzutage ein Abenteuer, und was gibt es Schöneres, als Abenteuer zu erleben? Und dann noch gemeinsam mit seinen Kindern? Für mich sind Smartphones vor allem Abenteuerverhinderungsmaschinen.
Dass der Handykonsum junger (und auch älterer Menschen) oft groteske, ja geradezu absurde Ausmaße annimmt, das leugnen nur wenige. Dass es gar nicht gut sein kann, wenn Kinder, die sich bewegen und sich mit anderen Kindern treffen sollten, ständig auf ein Minidisplay glotzen und in Panik geraten, sobald der Akku nur noch 13% anzeigt, leugnet vermutlich sogar niemand.
Ich empfehle daher, gemeinsam mit den Kindern digitale Auszeiten zu nehmen und sich auf das Abenteuer „analog“ einzulassen. Denn letztendlich zeigen wir unseren Kindern so, dass wir selbst in der Lage sind, auf ein Handy zu verzichten und Probleme auch mal ohne Handy zu lösen.
Und wenn wir das können, dann können es unsere Kinder auch.
(P.S.: Meiner Frau haben wir alles nach unserer Rückkehr erzählt. Sie hat gesagt: „Habt ihr denn nicht vorher auf GoogleMaps geschaut???“)
—– Zum Autor: Arne Ulbricht (www.arneulbricht.de), 47, ist Autor mehrerer Bücher. Heute erscheint sein erstes Kinderbuch. Arne Ulbricht wünscht sich mehr Lunas auf dieser Welt. Also Mädchen, die die Handys ihrer Eltern im Eisschrank verschwinden lassen, damit Mamas und Papas nicht so viel darauf herumtippen. 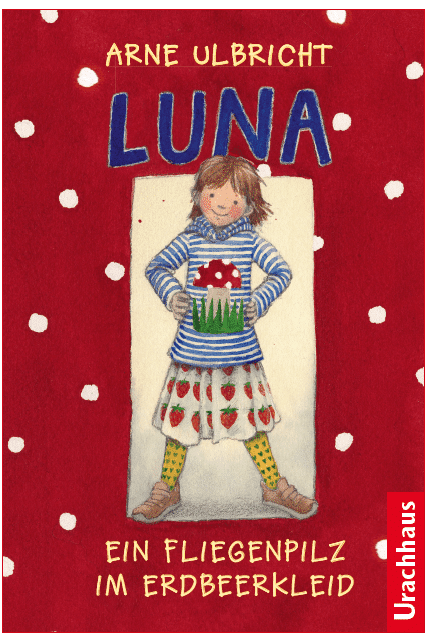
Bildquelle: talent! 2014®






















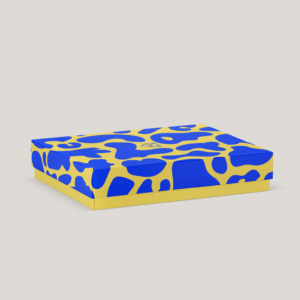




1 comment
Ganz ehrlich… Das
Ganz ehrlich… Das Hauptbeispiel ist für mich kein Abenteuer, sondern unnötiger Stress aufgrund mangelndem Organisationstalent. Es war knapp und hätte anders ausgehen können. Nicht jeder kann sich da problemlos neue Tickets für die nächste Fähre kaufen. Da schaue ich doch lieber, dass es glatt läuft.
Aber der eigentlichen Botschaft des Textes stimme ich völlig zu. Man sollte das Handy öfter mal un der Tasche lassen. Es ist gruselig wie abhängig wir von den Dingern sind und wieviel wir im wahren Leben verpassen, weil wir ständig darein starren.