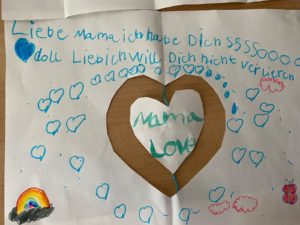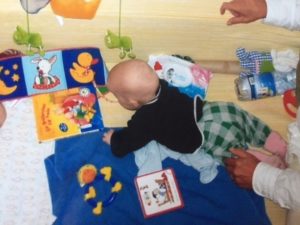Ihr Lieben, wir fragen uns alle, wie wir unsere Kinder möglich gut durch Unsicherheiten oder mögliche Ängste begleiten können. Psychologin und Autorin Elisabeth Raffauf sagt, wir können zusammen mit unseren Kindern schauen: Welche Angst ist eine Realangst? Welche Angst ist vielleicht erstmal nur in meinem Kopf? Und: Was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen?
In ihrem Buch Angst – Aufwachsen in unsicheren Zeiten und wie wir unseren Kindern helfen, mutig in die Welt zu gehen geht die Autorin noch genauer auf die Details ein, uns gibt sie hier im Interview aber schon wertvolle Einblicke.

Liebe Elisabeth, du hast ein Buch über die Angst geschrieben, wie kamst du darauf?
Im Gespräch mit Heike Hermann, der Lektorin vom Patmos-Verlag. Wir haben darüber gesprochen, was die Kinder und Jugendlichen und auch ihre Eltern zurzeit beschäftigt, was sie bewegt, was sie beunruhigt. Das sind unter anderem die großen Krisen auf der Welt, wie Krieg, Pandemien, Umweltkatastrophen, die viele von uns ratlos und ohnmächtig machen.
Und es wurde klar: Erwachsene Sorgen sind längst im Kinderzimmer angekommen. Dazu kommt, dass Ängste, die es immer schon gab, zugenommen haben: Die Angst zu versagen, die Angst vor Einsamkeit, vor Ausgrenzung und parallel der Sog der digitalen Welt…
Viele Leserinnen schreiben uns, dass ihnen die aktuelle politische Weltlage Angst macht – und nicht nur ihnen, auch ihren heranwachsenden Kindern. Wie können wir einen guten Umgang damit finden?
Das ist nicht für jeden gleich. Wichtig ist, dass wir hinschauen. Dass die Kinder wissen, sie können darüber sprechen und werden mit ihren Sorgen ernst genommen. Manche Eltern haben ja den sehr verständlichen Wunsch, die Katastrophen von ihren Kindern fernzuhalten. Aber das funktioniert nicht. Sie bekommen alles mit, durch die Medien, durch Schule und Kindergarten und als Erstes durch die Unsicherheit der Eltern. Deshalb sollten wir ihnen signalisieren: Deine Gefühle sind verstehbar und du kannst sie mit uns teilen. Dann können wir sie anschauen.
Ich hab immer das Bild „Wenn wir etwas aussprechen, können wir die Dinge außerhalb von uns selbst anschauen und ihnen einen Platz geben. Das reduziert die Angst. Dann können wir gemeinsam überlegen, welcher Umgang passt: Braucht das Kind mehr Informationen um sich sicherer zu fühlen, braucht es Schutz? Möchte es mehr wissen oder hat es nur eine ganz bestimmte Frage? Und dann können wir überlegen: Gibt es irgendwas ganz konkret zu tun, um aus der Ohnmacht herauszukommen?
Wie schaffen es Eltern, ihre eigenen Ängste nicht auf die Kinder zu übertragen?
Indem sie sie zulassen, sie sich selbst eingestehen und dann erstmal mit anderen Erwachsenen teilen und reflektieren. Sie können schauen: Welche Angst ist eine Realangst? Welche Angst ist vielleicht erstmal nur in meinem Kopf? Und: Was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen?
Mütter und Väter zweifeln auch viel an sich, weil sie keine Fehler mit ihren Kindern machen wollen… was kann das für Auswirkungen haben?
Zweifel sind ja erstmal nichts Schlechtes. Eltern können sie nutzen, um sich selbst in Frage zu stellen und ihre vielleicht auch widersprüchlichen Haltungen anzuschauen und aufzulösen. Wenn wir zweifeln, können wir genau das auch mitteilen. Die Kinder merken es sowieso.
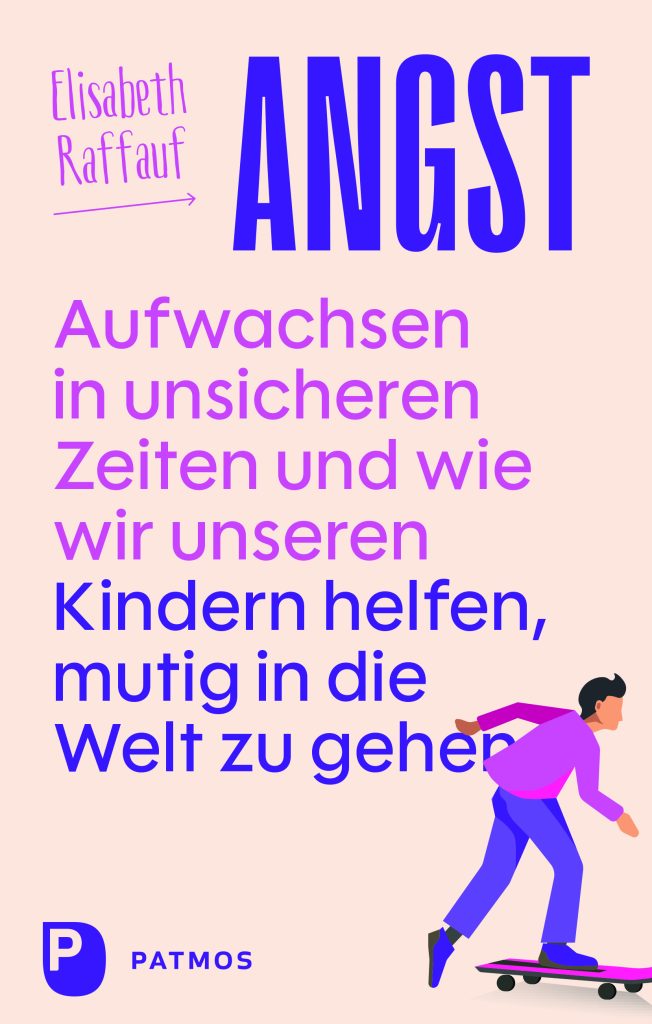
Wenn ich vom Pferd falle, heißt es: Am besten direkt wieder aufsteigen, damit sich die Angst nicht festsetzt. Wie lässt sich dieses Bild aufs Leben übertragen?
Auch das ist unterschiedlich. Grundsätzlich halte ich sehr viel davon auch erstmal anzuhalten und seine Gefühle zuzulassen. Wenn wir sie wegpacken, melden sie sich unter Umständen später an Stellen, wo wir sie nicht verstehen und nicht einordnen können. So ist es manchmal mit Panikattacken. Menschen beschreiben Panik in Situationen, die anderen ganz alltäglich erscheinen. Also: Innehalten und schauen: Muss ich sofort wieder aufsteigen? Oder habe ich Zeit zum anschauen? Mit wem könnte das gut gehen?
Wenn jemand einen Schicksalsschlag erlebt hat, kann er zwei unterschiedliche Wege gehen: Entweder das Leben jetzt erst recht mit vollen Löffeln zu sich zu nehmen, jeden Tag zu leben und nichts auszulassen oder sich in Sorge zurückzuziehen und ängstlich auf die Welt zu blicken. Ist das eine Entscheidung, die bei uns selbst liegt?
Ich finde man kann noch viel mehr und andere Wege gehen. Die Extreme sind oft nicht so hilfreich. Es ist nicht Entweder – oder, sondern Sowohl als auch. In Bezug auf die großen Probleme: Es ist wichtig sich der Welt zuzuwenden und zu schauen was passiert. Genauso ist es wichtig, auch zu schauen, wie kann ich, können wir unbeschwerte Zeit haben. Also ein Mittelweg hilft. Und auf deine Frage: Wir können umso mehr selbst entscheiden, desto mehr uns bewusst ist und wir vielleicht auch bearbeitet, (betrauert) haben.
Welche Erkenntnis hat dich beim Schreiben des Buches selbst überrascht?
Ich habe ja sehr viele Interviews mit Kindern und Jugendlichen geführt. Und ich war erstaunt, dass wirklich alle Kinder von großen Krisen wussten und sich sehr genau darüber Gedanken machen. Und zwar in zwei Richtungen: Was bedeutet das für die Welt? Und: Was bedeutet es für mich persönlich? Zum Beispiel wenn nichts gegen den Klimawandel getan wird oder wenn eine rechte Regierung an die Macht kommt.
Was bringt die Angst auch Gutes mit sich?
Wir erfahren mehr über uns. Die Angst ist ja die Alarmanlage des Menschen. Sie warnt uns vor Gefahren. Wenn wir die Angst nicht hätten, würden wir nicht lange leben. Also zum Beispiel die Angst vor der Klimakatastrophe ist eine reale Angst, die uns anzeigt: Es muss etwas getan werden.
Wie kann letztlich aus Angst Mut werden? Welchen Schalter können wir selbstbestimmt umlegen?
Es ist kein Schalter, eher ein Weg. Und der beginnt dabei, die Angst erstmal zuzulassen und sie anzuschauen. Gefühle benennen und erlauben ist eine wichtige Maßnahme bei Angst. Und dann kann ich fragen: Was kann ich tun? Wo brauche ich Unterstützung? Wo mache ich mir selbst Druck und kann ihn reduzieren?
Stichwort: Perfektionswahn. Wo kann ich meinen Kindern den Druck nehmen? Wo ihnen Leitplanken geben, und auch ihre Angst zulassen und mit ihnen teilen. Gleichzeitig wäre es hilfreich, wenn auf gesellschaftlicher Ebene etwas passiert: Weniger Druck perfekt sein zu müssen, ein Schulsystem, das individueller auf die Kinder eingehen könnte, wären ideal. Es gibt schon wichtige und hoffnungmachende Vorstöße in diese Richtung. (Ein paar habe ich in meinem Buch vorgestellt.)